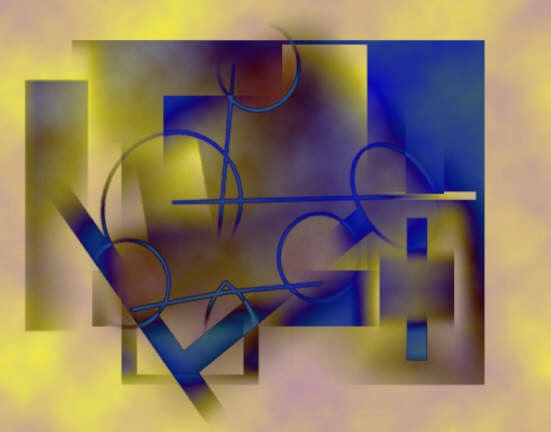aus derStandard.at, 29. 8. 2022 zu öffentliche AngelegenheitenKulturelle Aneignung ist für Robert Pfaller Komplize neoliberaler Umverteilung
Philosoph Robert Pfaller sieht in der Aneignungsdebatte einen problematischen Partikularismus wirksam werden.
Die Debatte um kulturelle Aneignung hat in den vergangenen Tagen absurde Züge an-genommen. Konzerte, die abgebrochen oder abgesagt wurden, weil weiße Musiker Dread-locks trugen, ein Verlag, der Begleitbücher zu einem Winnetou-Film nach Rassismus-Vor-würfen zurückzog. "Wir haben es hier mit einer tendenziellen Refeudalisierung der Gesell-schaft zu tun", kommentiert dies der österreichische Philosoph Robert Pfaller. Hier seien letztlich antidemokratische Kräfte am Werk.
In vielen Büchern, Artikeln und zivilgesellschaftlichen Initiativen ist der 1962 in Wien geborene und derzeit an der Kunstuniversität Linz lehrende Philosoph gegen Überreg-lementierung, Bevormundung des Bürgers und Infantilisierung der Gesellschaft aufgetre-ten. Fühlt er sich nun bestätigt – oder schüttelt er nur noch den Kopf? "Beides natürlich", schmunzelt Pfaller im Gespräch mit der APA. "Ich fühle mich bestätigt – eben darin, dass ich schon lange den Kopf schüttle. Das Entscheidende, das man dazu sagen muss, ist ja, dass Leute, die solche Forderungen erheben, offenbar nicht wirklich an der Emanzipation der Gruppen interessiert sind, in deren Namen sie zu sprechen behaupten."
Nur scheinbar von Benachteiligten
Die aktuelle Aneignungs-Diskussion sei "auf jeden Fall in einem großen politischen Zusammenhang zu sehen. Diese postmoderne Kulturpolitik ist der Komplize und der Profiteur der neoliberalen Umverteilung und Entdemokratisierung der Gesellschaft. Das zerstört genau die Terrains, die in Europa und an einigen anderen Orten seit der frühen Neuzeit mühsam erkämpft wurden – eben, dass man in der Öffentlichkeit von den Besonderheiten der Anderen absieht und sie als gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen betrachtet. Das mag eine Fiktion sein, aber das ist eine sehr entscheidende Fiktion, um überhaupt Demokratie zu ermöglichen."
Peter Sloterdijk habe schon vor vielen Jahren festgestellt, "dass sich die Macht heutzutage gerne mit der Schwäche paart und tarnt". Gleiches sei nun zu konstatieren: "Das sind Initiativen, die zwar scheinbar von den Benachteiligten ausgehen. Aber der starke Effekt, den sie auf die Gesellschaft haben, rührt daher, dass sie den Mächtigsten erlauben, andere zum Schweigen zu bringen, die in der Lage wären, eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu üben oder auch nur demokratische Mitbestimmung einzufordern."
Entdemokratisierte Unis
Als Beispiel aus seiner unmittelbaren Erfahrung nennt Pfaller "die Universitäten, die in den letzten Jahren nicht nur in Österreich extrem entdemokratisiert wurden. Die universitäre Mitbestimmung ist seit dem Universitätsgesetz von 2002 eine Farce. Unter diesen Bedingungen ist es für die monokratischen Leitungsorgane sehr hilfreich, wenn man etwa Studierende hat, die sich darüber beschweren, dass sie in einem bestimmten Seminar mit verletzender Sprache konfrontiert worden wären oder mit verletzenden Motiven der studierten Inhalte. Das hilft den Rektorinnen und Rektoren, Macht auszuüben über kritische Mitarbeiter der Universität. Damit kann man sie einschüchtern."
Robert Pfaller zitiert aus dem "Anthropophagischen Manifest" des Brasilianers Oswald de Andrade (1890-1954), der darin zum kulturellen Kannibalismus aufrief: "I'm only interested in what's not mine." Diese Offenheit für das Andere habe zu einer globalisierten Weltkultur geführt. Es ist eine Fiktion zu glauben, dass man die Urheber von bestimmten kulturellen Hervorbringungen "ethnisch, territorial oder sonst wie ausfindig machen könnte. Darf etwa Curry-Huhn nur von Leuten aus Indien zubereitet werden? In Indien gibt es aber sehr viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen – und sie verwenden diverse Zutaten, die von spanischen, portugiesischen und britischen Handelsschiffen aus anderen Kontinenten gebracht wurden."
Heute habe sich "Multi-Kulti" in Abgrenzung und "ghettoisierenden Partikularismus" verwandelt. "Die Debatte um kulturelle Aneignung ist eine Strategie, die darauf abzielt, marginalen oder subalternen Gruppen eine kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft zu verunmöglichen. Es wird so getan, als ob diese Gruppen nicht in der Lage wären, irgendetwas hervorzubringen, das auch für alle anderen Wert und Gültigkeit besitzt. Damit entmündigt man sie."
Pfaller bringt ein Beispiel: "Wenn man etwa sagt, die kulturellen Errungenschaften der Schwarzen in den USA dürfen von niemandem anderen genutzt werden, dann ist das genauso, wie wenn man sagte: 'Wenn Sie nicht aus der Arbeiterklasse stammen, dürfen Sie keine Rockmusik hören oder keine Lederjacken tragen.' Dass das aber getan wurde, war keine schändliche kulturelle Aneignung, sondern ein kulturpolitischer Erfolg der Linken. Es ist gelungen, sogar den Klassenfeind zu zwingen, sich für die proletarische Kultur zu interessieren und sie zu würdigen. Und die 'Aneignung' des Blues durch Elvis Presley und die Rolling Stones hat der schwarzen Musik zu Anerkennung und weltweiter Bekanntheit und Erfolg verholfen."
Robert Pfaller warnt vor einer "problematischen Essentialisierung" von Gruppen. "Gruppen sind heterogen. Wenn man also sagen würde: Die Österreicher sind subaltern gegenüber den Deutschen, und wenn sich Deutsche Lederhosen kaufen, ist das kulturelle Aneignung, dann tut man so, als ob alle Österreicher Lederhosen tragen würden." Stattdessen solle gelten: "Kultur gehört allen, die ihre Träger sind." Womit nicht nur Lederhosenträger gemeint sind.
Nota. - Habe ich Robert Pfaller gestern Unrecht getan, als ich ihn für einen Parodisten hielt? Heute mach ichs wieder gut und nehme ihn ernst.
Jede Kultur, wo und wann immer sie auftaucht, ist ein Beitrag zum Welterbe der Mensch-heit. Nicht jede versteht sich so. Manche ist absichtsvoll partikularistisch, exklusiv und eigensüchtig. Nicht alle Kulturen sind eben gleich gut. Will sagen: Nicht jeder Bestandteil einer jeden Kultur ist ein Beitrag zum Welterbe. Manches gehört ausgeschieden.
Sammeln und Ausscheiden: Die Sichtung und Bewahrung ihrer Werte - manchmal passt sogar dieses Wort - nennen wir den Forstschritt der Zivilisation.
Das kann nicht geschehen in einem globales Amalgam, wo alles, was die einzelnen Kultu-ren gegeneinander profiliert, in Indifferenz versinkt. Die Eigenheit des Besonderen zu wahren und verteidigen, ist Sache derer, die es wert schätzen. Dabei konkurrieren sie, wie es in Künsten und Wissenschaften unabdingbar ist. Sie konkurrieren miteinander, und jeder, der was vorweisen kann, darf es.
Es ist auf unserm Planeten durch Kriege, Massaker und andere Katastrophen eine Kultur erwachsen, die eben darin ihre auszeichnende Besonderheit erkennt; die westliche. Darum reden wir von einer westlichen Zivilisation.
JE
Nota. Das obige Bild gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog. JE
 zu Philosophierungen
zu Philosophierungen